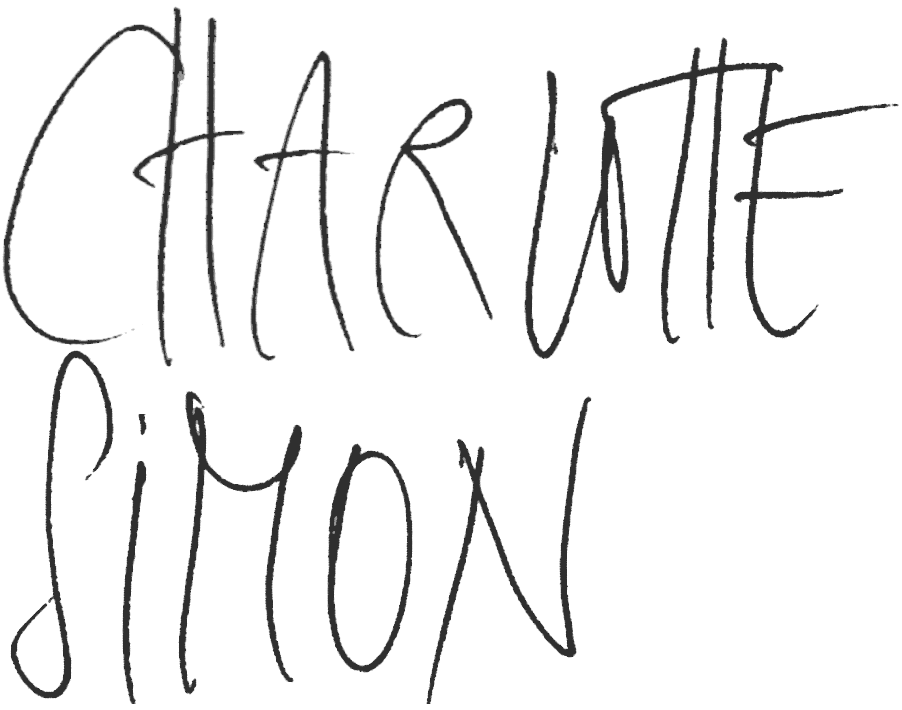Ausstellung von Charlotte Simon in New Orleans vom 12.10. – 3.11.2013
Verwandlungen
Beate Ermacora
Bevor sich Charlotte Simon der Malerei zuwandte, war sie lange Jahre als Schauspielerin tätig. Die Erfahrungen, die sie am Theater sammelte, fließen auch in ihr künstlerisches Werk ein, in dem wir immer wieder auf Menschen treffen, die tierische Merkmale tragen, gar mit Tieren zu verschmelzen scheinen, aber auch von ihrer Umgebung wie durchdrungen wirken. Angesichts Simons Bilderkosmos ist man an Ovids Metamorphosen erinnert, wo sich ständig alles wandelt, auf wunderbare Weise ineinander übergeht und keine Erscheinung ihre Gestalt behält, sondern Menschen und Götter zu Tieren oder Pflanzen werden können, Zeit und Raum nicht still stehen und die Wirklichkeit neu erschaffen wird. Ovid begreift die Natur als Verwandlerin aller Dinge, die stets aus alten erneuerte Formen hervorbringt, jedoch ohne dass sich im Wesen etwas ändert. Schlüpft man im Schauspiel in Rollen, so geht es nicht nur um den Aspekt der Verkleidung, sondern auch darum, die Mentalität von jemand anderem ganz und gar zu verkörpern. Nach Ende des Stücks kehrt man wieder zu sich selbst zurück, hat jedoch vielleicht gedanklich etwas mitgenommen, das man in die eigene Persönlichkeit integrieren kann. Charlotte Simon spielt mit all diesen Assoziationen, lässt Märchenhaftes anklingen und schafft rätselhafte, magische, mitunter auch skurril anmutende Atmosphären. Mit ihren Bildideen visualisiert sie komplexe Fragen nach der Identität des Individuums, nach der Beziehung des Menschen zur Natur oder danach, wie äußere Einflüsse, der Kontakt mit der Umwelt und den Mitmenschen Gedanken, Gefühle, Handlungen, ja auch das eigene Erscheinungsbild formen und verformen können, sodass man sich verändert. Doch auch die körperliche und mentale Energie ihrer Protagonistinnen und Protagonisten scheint umgekehrt stark genug zu sein, um Einfluss auf ihre Umgebung auszuüben.
In einer Reihe von Gemälden, die Simon mit Eitempera – einem farbintensiven Malmittel – auf Holz angelegt hat, sehen wir Menschen in unterschiedlichen Beziehungen und Posen zu Tieren. Unter dem Titel „Mütze I“ (2011) ist eine indianisch aussehende Frau mit ornamentierter Kopfbedeckung und einem Eichhörnchen auf dem Arm hoch oben über einer weiten Berglandschaft im Profil dargestellt. In „Susanne am Silbersattel“ (2011) sitzt der Genannten ein Äffchen auf der Schulter, was ihr ziemliches Unbehagen zu bereiten scheint. In beiden Bildern blicken nicht die Menschen auf den Betrachter, sondern die Tiere fordern unseren Blick heraus. Während hier Tiere den Personen attributhaft zugeordnet werden und wie schamanische Krafttiere wirken, die beschützen und helfen sollen, lässt die Künstlerin in anderen Arbeiten Verwandlungen stattfinden. Einer Frau, die ein kleines Schweinchen wie eine Pistole vor sich hält ist in „Pigpistol“ (2012) ein rosa Schweineohr gewachsen und ein überaus verloren wirkender Mann durchstreift als „Zebra“ (2012) mit schnellem Schritt und suchendem Blick den nur mit bläulichen Schlieren angedeuteten leeren Bildgrund. Dass es sich bei diesen Transformationen wohl nicht um einen schnell wieder rückgängig zu machenden Faschingsscherz handelt, sondern um eine ernste Angelegenheit, zeigen ihre Mienen und Haltungen und es scheint ihnen schwer zu fallen, sich mit den Eigenschaften der Tiere, zu denen sie geworden sind, zu identifizieren. In diesem inhaltlichen Kontext kann auch „Pelzebub“ (2013) gesehen werden. Allerdings ist das Fell, in das der Mann gehüllt ist, den der Titel in die Nähe des teuflischen Beelzebubs rückt, ein Mantel. Angesichts der haarigen Rauchblase, die statt Zigarettenqualm aus seinem Mund kommt, stellt sich die Frage, ob diese zweite Haut nicht doch bereits in das Innere übergegangen ist. Es sind wie hier bloß surreale Andeutungen, mit denen die Künstlerin gerne spielt, um dem Betrachter genügend eigenen Assoziationsspielraum zu lassen.
Den Gemälden zur Seite stehen großformatige Papierarbeiten in einer besonderen Technik. Neben der Verwendung von Aquarell- und Acrylfarben, Buntstiften und Bleistift bringt Charlotte Simon Kaffee zum Einsatz, der ein ganz besonderes Braun auf die Blätter zaubert. Oft verwendet die Künstlerin die Farbe als eine Art Grundierung, die sie unterschiedlich dicht, fleckig oder wolkig, je nachdem welche landschaftlichen oder figürlichen Assoziationen sie hervorrufen will, aufträgt. Dabei gibt es immer wieder Variationen eines Themas wie bei „Spaziersprung“ (2013) oder „Wannekind“ (2013). Wie in „Spaziersprung“, „Auf der Wiese“ (2012) oder „Im Garten“ (2012) wird Räumlichkeit mit nuancierten Farbabstufungen in den Tönen Braun, Beige, Weiß vage angedeutet, gezielt eingesetzte Farbtupfer in Rot, Rosa oder Hellblau setzen Akzente, umschreiben aber nicht unbedingt lesbare Bilddetails, sondern bleiben abstrakt. In den Bildgründen, die bisweilen wie Unterwasserlandschaften wirken, in denen Gräser auch Haare sein können, kann man merkwürdige Wesen erkennen die mal Mensch, mal Tier, mal Elfen, mal alles zugleich zu sein scheinen. Sie schweben, haben keinen festen Halt, tauchen aus den Farbschlieren auf und führen ein ephemeres Leben. In ihnen scheint sich der Satz „Ich setzte den Fuß in die Luft, und sie trug.“ der Lyrikerin Hilde Domin zu bewahrheiten, der für Charlotte Simon einen Leitfaden darstellt.